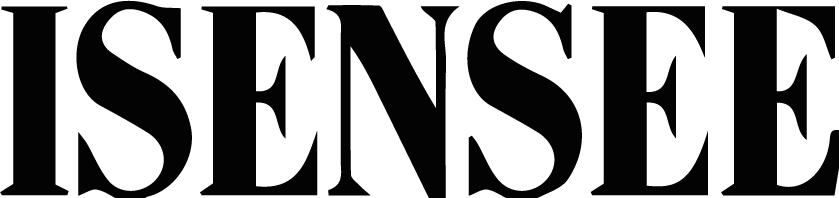0 Artikel - 0,00 €
- Keine Produkte im Warenkorb
Die Heldenburg bei Salzderhelden, Stadt Einbeck, zählt zu den wichtigen Burgen in Südniedersachsen. Sie wurde 1306 erstmals schriftlich erwähnt, für das Jahr 1321 ist die Bezeichnung castrum Helden überliefert.
Beim Blick durch den Bauzaun oder bei einer Führung über eine Ausgrabung zeigt sich eigentlich immer das gleiche Bild: Wenn Archäologen niederknien, haben sie etwas gefunden, dann wird gemessen, gezeichnet, fotografiert und geborgen.
Inszenierte Archäologie? Funde und Befunde sprechen doch für sich, in jedem Museum ist das ja ganz offenkundig zu sehen. Doch von der Ausgrabung in die Vitrine, zur Ausstellung oder sogar bis zur Rekonstruktion führt ein weiter und manchmal steiniger Weg.
Arm oder reich? Fundsituationen mit vielen, auch kostbaren Funden und solche mit wenigen oder sogar ganz ohne Funde werden schnell, nicht selten vorschnell, in Kategorien wie viel = reich, wenig (oder nichts) = arm unterteilt. Aber sind unsere heutigen Wertevorstellungen wirklich auf vorgeschichtliche Verhältnisse übertragbar?
Das frühe Mittelalter im Braunschweiger Land: ein Zeitabschnitt mit tiefgreifenden Umwälzungen, aber auch mit einer durchaus spärlichen Quellenlage, an deren Ende dann mit den Orten Königslutter und Braunschweig königliche Herrschaft eng verknüpft ist.
In den felsgeprägten Tälern des Leineberglandes bei Göttingen sind zahlreiche Behausungen urgeschichtlicher Menschen auch heute noch zu besuchen und zu erkunden.
In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts beteiligte sich Gerbert von Stotel als frisch ernannter Edelherr an einem päpstlich angeordneten Kreuzzug gegen die Stedinger Bevölkerung und ging als Kriegsgewinner daraus hervor. Er baute sich einen neue, mit einer Steinmauer befestigte Burg in der Lune-Niederung und manifestierte damit sehr eindrucksvoll seine neu erlangten Herrschaftsansprüche.
Niedersachsen ist ein für seine wechselvollen Landschaften bekanntes Bundesland: von den Höhen des Harzes, über sandige Heideregionen und nasses Moor bis an die einzigartige Küste.